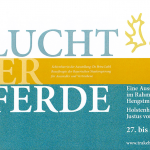Seit der Aufnahme des Tierschutzes in Artikel 20a des Grundgesetzes im Jahr 2002 ist der Schutz der Tiere verfassungsrechtlich verankert. Dort heißt es:
„Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürliche Lebensgrundlagen und die Tiere(..)“.
Diese Formulierung hebt den Tierschutz auf die Ebene eines verfassungsrechtlichen Leitprinzips. Damit ist der Staat verpflichtet, die Belange des Tierschutzes bei allen politischen, rechtlichen und gesellschaftlichen Entscheidungen zu berücksichtigen und bringt ihn auf eine verfassungsrechtliche Ebene.
Das Tierschutzgesetz (TierSchG) konkretisiert diese verfassungsrechtliche Verpflichtung: Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen, wie § 1 TierSchG normiert. Im Kontext des Pferdesports bedeutet dies, dass jede Trainings- und Wettkampfmethode, jede Ausrüstung und jede Regelung daraufhin geprüft werden muss, ob sie mit dem Tierwohlgedanken vereinbar ist. Der Turniersport steht damit immer im Spannungsfeld zwischen sportlicher Leistungsförderung und tierschutzrechtlicher Verantwortung.
Umso mehr stößt die geplante Anpassung des Weltreiterverbandes FEI hinsichtlich der „Blutregel/Blood rule“ auf Kritik.
Sowohl die Fédération Équestre Internationale (FEI) als auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) haben in den vergangenen Jahren eine Reihe konkreter Maßnahmen ergriffen, um den Tierschutz im Pferdesport zu stärken und das Wohl des Pferdes mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Hintergrund dessen waren, zahlreiche Debatten um Ausrüstung, Reitweisen und Leistungsanforderungen innerhalb des Wettkampfs.
Die FEI verfolgt seit 2024 mit ihrem „Equine Welfare Strategy Action Plan“ eine umfassende Strategie, die das Ziel hat, die gesundheitlichen, physischen und psychischen Bedürfnisse der Sportpferde systematisch zu berücksichtigen und in Einklang mit dem Tierwohlgedanken zu bringen. Ergänzend dazu hat die FEI zahlreiche Änderungen in ihrem Regelwerk beschlossen, die seit 2025 in Kraft getreten sind. Dazu zählen unter anderem präzisere Nasenriemenkontrollen durch Stuarts, die sicherstellen sollen, dass die Verschnallung der Zäumung dem Pferd keine Schmerzen oder Atemeinschränkungen zufügt. Außerdem wurde das Kürzen der Ohrhaare („ear trimming“) verboten, da diese für das Pferd ein wichtiges Sinnesorgan darstellen.
Darüber hinaus hat die FEI, die Vorgaben für Ausrüstung und Gebisse verschärft, um Manipulationen und unzulässige Hilfsmittel zu verhindern. Der seit Jahren geltende „FEI Code of Conduct for the Welfare of the Horse“ bleibt dabei das zentrale Leitprinzip der FEI und dient dem Wohl des Pferdes unabhängig von sportlichen oder kommerziellen Interessen. Darin heißt es: „The welfare of the horse must be paramount and must never be subordinated to competitive or commercial influences.”
Auch auf nationaler Ebene hat die FN den Tierschutz in den letzten Jahren deutlich stärker betont. Die FN legt mit ihren Leitlinien für den Tierschutz im Pferdesport fest, dass „das Pferd als Partner des Menschen in seiner Würde und Integrität zu achten“ ist und „Schmerzen, Leiden und Schäden zu vermeiden“ sind.
Mit der Überarbeitung der Leistungsprüfungsordnung (LPO) wurde klargestellt, dass Verstöße gegen das Wohl des Pferdes nicht nur im Wettkampf, sondern auch außerhalb des Turniers geahndet werden können. Ab 1. Januar 2026 tritt zudem ein verschärfter Strafrahmen in Kraft, wodurch schwerwiegende Verstöße gegen den Tierschutz künftig mit hohen Bußgeldern und langen Turniersperren geahndet werden können. Ein Teil der Bußgelder soll dabei in Tierschutz- und Aufklärungsmaßnahmen reinvestiert werden.
Darüber hinaus engagiert sich die FN mit Initiativen für bessere Haltungs- und Ausbildungsbedingungen für Schulpferde. Sinn und Zweck ist es, den Tierschutz bereits den jüngsten Reitern zu vermitteln und so an die Ethik des Reitsports bei der Ausbildung von Nachwuchsreitern und im Breitensport zu appellieren.
Diese Maßnahmen zeigen, dass sowohl internationale Verbände wie die FEI, als auch nationale Pferdesportverbände grundsätzlich den Anspruch verfolgen, den Spagat zwischen sportlichem Erfolg und Tierschutzbewusstsein zu meistern.
Umso widersprüchlicher vermag die neuste Mitteilung der FEI zur Anpassung ihres Reglements erscheinen. Jüngst hat die FEI bekannt gegeben, dass sie die „Blutregel“/ „Blood rule“ anpassen möchte. Die FEI hatte bislang festgelegt, dass sichtbares Blut bei Pferden im Wettkampf zur Eliminierung (Disqualification) führt. Sinn und Zweck der Regelung sind Tierschutzgesichtspunkte, die die Pferde vor Leiden und Schmerzen schützen sollten. Sie regelt, wie mit Pferden umzugehen ist, die im Wettkampf Blutspuren zeigen, wie etwa durch Maulverletzungen oder durch den Einsatz von Sporen am Körper. Nunmehr soll eine Lockerung stattfinden, die festlegt, dass in gewissen Fällen künftig ein Verwarnungsverfahren gelten soll, dass nicht zwingend zum Ausschluss führt, wenn das Pferd blutet. Sichtbares Blut im oder um das Pferdemaul, soll zukünftig in „milden Fällen“ erlaubt sein und führt nach dem Ausspülen nicht zu einem Ausschluss aus dem Wettkampf. Erst ab zwei Verwarnungen innerhalb eines Kalenderjahres würde dies zu einer Sperre und einem Bußgeld führen.
Eine Lockerung dieser Regel, wie sie aktuell von der Fédération Équestre Internationale (FEI) diskutiert wird, berührt damit nicht nur sportethische, sondern auch verfassungsrechtlich relevante Fragen:
Wie lässt sich eine mögliche Duldung sichtbarer Blutspuren mit dem Staatsziel Tierschutz und nationalen Regeln vereinbaren? Wo liegt die Grenze zwischen sportlicher Härte und tierschutzrechtlicher Zumutbarkeit? Erfüllt der internationale Pferdesport dann überhaupt noch eine Vorbildfunktion für Nachwuchsreiter?
Der Weltreiterverband muss sich die Fragen stellen, wenn er seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden möchte, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung des Tierschutzes auf nationaler Ebene und für Nachwuchsreiter. Denn nur ein Reitsport, der das Wohl des Pferdes über sportliche und finanzielle Interessen stellt, kann langfristig gesellschaftliche Akzeptanz und rechtliche Legitimation behalten.
Sowohl die FEI als auch nationale Verbände wie die FN verpflichten sich in ihren Statuten ausdrücklich zum Wohl des Pferdes.
Eine Regeländerung, die die Akzeptanz sichtbarer Blutspuren im Wettkampf vorsieht, steht damit zumindest ethisch im Widerspruch zu diesen Grundsätzen. Die Lockerung könnte den Eindruck erwecken, dass sportliche Interessen über das Wohl des Pferdes gestellt werden. Besonders kritisch wäre dies, wenn Blutungen als bloß „optisches Problem“ und nicht als möglicher Ausdruck von Schmerz oder Überforderung des Tieres ausgelegt würden. Denn fraglich ist bereits, die Bewertung, wann ein Pferd bei Blut im Maul Schmerzen hatte und wann nicht. Letztlich obliegt die Entscheidung für die Sanktion und die damit verbundene Eliminierung vom Wettkampf dem Stuart innerhalb weniger Minuten. Ob eine derartige konkrete Bewertung in kurzer Zeit vor einem Start von den Stuarts abverlangt werden kann, ist fraglich. Zudem ist nicht sichergestellt, wie ohne umfassende veterinärmedizinische Untersuchung gewährleistet werden kann, dass das Pferd keine schwerwiegenden inneren Verletzungen in der Maulhöhle erlitten hat. Die FEI erläutert bislang nicht, inwiefern die Maßstäbe gesetzt werden, wann von schmerzhaftem Bluten und wann von hinnehmbarem Bluten ausgegangen werden kann.
Auch für Nachwuchsreiter und den Breitensport könnte eine Lockerung dieser Regel zu einer Verharmlosung von tierschutzrelevantem Verhalten führen und dem Turniersport als solches einen immensen Imageschaden zufügen. Bereits nach der Rollkur-Debattte sowie dem olympischen Fünfkampf, stieß der Pferdesport auf große Kritik. Die geplante Lockerung der „Blutregel“, die objektiv den Tierschutz schwächt, könnte daher in Deutschland nicht widerspruchsfrei angewendet werden, da sie gegen den Inhalt des Art. 20a GG und die Vorgaben des Tierschutzgesetzes verstieße. Auch die FN äußerte sich mit einer Pressemittelung kritisch gegenüber der geplanten Lockerung.
Zwar richtet sich diese Verpflichtung zur Einhaltung des Tierschutzes primär an staatliche Stellen – nicht unmittelbar an private Organisationen wie die FEI. Doch sobald staatliche Institutionen oder öffentliche Gelder in den Pferdesport involviert sind, etwa durch Förderung, Genehmigungen, öffentliche Repräsentation bei internationalen Turnieren, entsteht eine mittelbare Bindung an das Staatsziel auch auf internationaler Ebene. Deutsche Reiter, Veranstalter und Verbände, die der FEI unterliegen, handeln somit in einem verfassungsrechtlich relevanten Rahmen.
Die FEI ist ein privatrechtlich organisierter, internationaler Sportverband mit Sitz in der Schweiz, mithin nicht der EU. Ihre Regelwerke sind keine staatlichen Normen, sondern unterliegen Verbandsrecht und letztlich der Zuständigkeit des Court of Arbitration for Sport (CAS) in Lausanne. Jeder Athlet bindet sich vertraglich an das Regelwerk der FEI und erklärt sich hiermit einverstanden. Wenn sich Sportler gegen Vorwürfe verteidigen müssen oder gegen Urteile der Sportgerichte vorgehen wollen, müssen sie sich an den CAS wenden.
Mit anderen Worten: Selbst wenn die FEI international eine Lockerung beschließt, wäre deren Umsetzung in Deutschland nur im Rahmen der nationalen Rechtsordnung zulässig. Nationale Verbände müssten sie ggf. einschränken oder ablehnen, um mit deutschem Recht vereinbar zu bleiben.
Sollte allerdings eine nationale Umsetzung der FEI-Regel – etwa durch die FN – mit zwingendem nationalen Recht, insbesondere dem deutschen Tierschutzgesetz oder Artikel 20a GG, kollidieren, könnte eine gerichtliche Auseinandersetzung auch in Deutschland geführt werden.
Eine Lockerung der FEI-Blutregel würde erhebliche Fragen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit ethischen Prinzipien, nationalem Recht und dem Staatsziel Tierschutz aufwerfen. Während die FEI als internationaler Verband rechtlich autonom agieren kann, sind nationale Verbände wie die FN an deutsches Verfassungs- und Tierschutzrecht gebunden. Eine unkritische Übernahme einer gelockerten Regelung könnte daher in Konflikt mit Artikel 20a GG und den Grundsätzen der FN geraten.
Letztlich bleibt der Druck auf die FEI, ihre Regelungen so zu gestalten, dass sie mit den ethischen und rechtlichen Standards der Mitgliedsländer vereinbar bleiben, denn nur so lässt sich die gesellschaftliche Akzeptanz des Pferdesports langfristig sichern. Auch die Reputation von Sportlern und deren Vorbildfunktion für Nachwuchsreiter und den Breitensport, sollte bei der Lockerung der „Blutregel“ Berücksichtigung finden. Außerdem darf die Schnelllebigkeit der sozialen Medien bei der Lockerung einer Regelung, die eigentlich dem Tierschutz dienen sollte, nicht in Vergessenheit geraten – Fotos und Videos lassen sich immer schneller Verbreiten und haben so schon zu einem regelrechten „Shitstorm“ für Betroffene geführt. Die Lockerung der „Blutregel“ kann, ohnehin schon kritische Stimmen des Pferdesports, nur noch lauter werden lassen und zu datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Verstößen führen, wenn es um die Debatte des pferdefreundlichen Turniersports geht.
Alicia Zimmer, Rechtsreferendarin und ambitionierte Reiterin. Ihre Leidenschaft für Pferde und Recht hat sie im Pferderecht zusammengeführt – sie arbeitet als Autorin und befasst sich mit rechtlichen Fragen rund um den Reitsport.